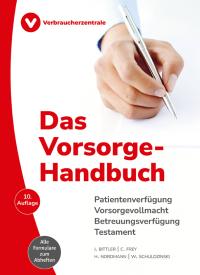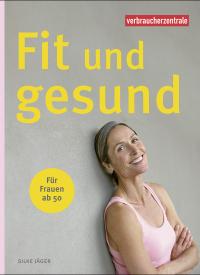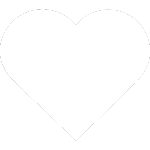- „Bezeichnung des Lebensmittels“ – wichtige Produktinformationen oft versteckt
Lebensmittel tragen oft Fantasienamen wie "Erdbeertraum" oder "Wild Strawberry". Erst die Bezeichnung "Milchmischgetränk aus Magermilch mit Erdbeergeschmack" gibt Ihnen Klarheit, um welche Art von Lebensmittel es sich konkret handelt.
Für manche Lebensmittel ist die Bezeichnung rechtlich festgelegt, zum Beispiel für Fruchtsaft, Honig oder Milch. Fehlt diese Vorschrift für ein Produkt, kann der Hersteller die verkehrsübliche Bezeichnung nutzen oder selbst eine Beschreibung wählen wie etwa "Nudeln in Tomatensauce mit 2 % Broccoli und 1 % Käse".
Diese für Sie als Verbraucher:in wichtige Produktinformation findet sich jedoch häufig auf der Rückseite der Verpackung. Aus Sicht der Verbraucherzentralen sollten die wesentlichen Eigenschaften des Produkts klar und deutlich auf der Vorderseite der Verpackungen stehen, so auch die Bezeichnung des Lebensmittels.
- Was verrät das Zutatenverzeichnis?
Das Zutatenverzeichnis informiert Sie über die Zusammensetzung des Lebensmittels. Hieran können Sie erkennen, ob das Produkt Zutaten enthält, die Sie vermeiden möchten: Bei verpackten Lebensmitteln müssen – mit einigen Ausnahmen – die für das Produkt verwendeten Zutaten, darunter auch Zusatzstoffe und Aromen, aufgelistet werden. Die Zutaten müssen in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils genannt werden.
Bei Zutaten, die ihrerseits aus verschiedenen Zutaten bestehen, wie Salami auf der Pizza, müssen alle Einzelbestandteile angegeben werden. Entweder werden diese, entsprechend der mengenmäßigen Reihenfolge im Verzeichnis aller Zutaten integriert oder das zusammengesetzte Lebensmittel wird genannt und dahinter werden in Klammern die Einzelzutaten aufgezählt.
Bei zusammengesetzten Zutaten, die weniger als zwei Prozent ausmachen und deren Zusammensetzung rechtlich definiert ist, ist eine genaue Aufschlüsselung nicht notwendig. In der Zutatenliste reichen hier beispielsweise die Hinweise "Schokolade" oder „Konfitüre“. Auch bei Gewürz- und Kräutermischungen, die unter zwei Prozent der Gesamtmenge liegen, müssen die einzelnen Bestandteile nicht genannt werden, ausgenommen Allergene wie Sellerie.
Zusatzstoffe müssen mit ihrem Klassennamen, wie Farbstoff oder Konservierungsmittel, genannt werden, sowie mit der E-Nummer oder ihrer speziellen Bezeichnung. Die Angabe kann zum Beispiel "Verdickungsmittel E 412" oder "Verdickungsmittel Guarkernmehl" lauten.
Für Lebensmittel aus einer einzigen Zutat, wie Milch, ist das Zutatenverzeichnis nicht vorgeschrieben.
In der Zutatenliste müssen keine Angaben zu Zusatzstoffen, Enzymen, Lösungsmittel und Trägerstoffen (für Zusatzstoffe, Aromen und Vitamine) gemacht werden, die im Endprodukt keine technologische Wirkung mehr haben. Das gilt auch für Verarbeitungsstoffe, die aus dem Produkt wieder entfernt wurden. Nur wenn dabei ein Stoff eingesetzt wurde, der als Allergen gekennzeichnet werden muss, muss der Hersteller diesen Stoff (das Allergen) nennen
- Allergene müssen besonders hervorgehoben werden
Für Menschen mit Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten ist es wichtig, für sie unbedenkliche Lebensmittel auszuwählen. Die 14 Hauptallergene müssen in der Zutatenliste besonders hervorgehoben werden, zum Beispiel in Großbuchstaben oder fett gedruckt.
Ist kein Zutatenverzeichnis vorgeschrieben, so muss auf das Allergen mit dem Wort "enthält" hingewiesen werden. Bei Lebensmitteln, aus deren Bezeichnung sich das Allergen ergibt, zum Beispiel bei Milch, ist die gesonderte Kennzeichnung – in diesem Fall Milch – nicht erforderlich.
Die Allergene, die laut Lebensmittelinformationsverordnung (Anhang II) gekennzeichnet werden müssen, sind:
- glutenhaltige Getreide und Produkte daraus *
- Krustentiere und daraus hergestellte Produkte
- Eier und daraus hergestellte Produkte
- Fisch und daraus hergestellte Produkte
- Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte
- Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte
- Milch und Produkte daraus (einschließlich Laktose)
- Schalenfrüchte (Nüsse) **
- Sellerie und daraus hergestellte Produkte
- Senf und daraus hergestellte Produkte
- Sesamsamen und daraus hergestellte Produkte
- Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 Milligramm pro Kilogramm oder 10 Milligramm pro Liter, ausgedrückt in SO2
- Lupinen und daraus hergestellte Produkte
- Weichtiere und daraus hergestellte Produkte
* mit Nennung der Zutat Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme
** mit namentlicher Nennung der Zutat Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse
- Welche Nährwerte müssen angegeben werden?
Auf Lebensmittelverpackungen muss der Energiegehalt in kcal und kJ sowie die Menge der folgenden sechs Nährstoffe, bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter, angegeben werden:
- Fett
- gesättigte Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- Zucker
- Eiweiß
- Salz
Das gilt nicht für Nahrungsergänzungsmittel. Bei Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung müssen darüber hinaus Angaben zum Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Cholin und Ballaststoffen gemacht werden. Diese Angaben müssen sich auf die Portion beziehen - nicht auf 100 Gramm.
- Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum: Was bedeutet das MHD?
Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das Lebensmittel in der ungeöffneten Packung bei richtiger Lagerung seine spezifischen Eigenschaften, wie Geruch, Geschmack und Nährstoffe behält.
Hinter dem Wortlaut: "mindestens haltbar bis" oder "mindestens haltbar bis Ende" muss entweder das Datum selbst stehen oder der Hinweis, wo es auf der Verpackung zu finden ist.
Für manche Lebensmittel hängt die Haltbarkeit von bestimmten Bedingungen ab, zum Beispiel der Lagertemperatur. Dies muss dann auf dem Etikett angegeben sein: Beispiel Milch "Bei 8 °C mindestens haltbar bis".
Bei Lebensmitteln, deren Haltbarkeit weniger als drei Monate beträgt, müssen der Tag und der Monat angegeben werden, bei Haltbarkeit von drei bis 18 Monaten, der Monat und das Jahr.
Bei Lebensmitteln, die mehr als 18 Monate haltbar sind, reicht die Angabe des Jahres.
Ausnahmen: Für bestimmte verpackte Lebensmittel ist kein MHD vorgeschrieben. Dazu zählen frisches Obst und Gemüse (Ausnahme: Keime und Sprossen), Zucker, Speisesalz (Ausnahme: Salz mit Zusätzen wie beispielsweise Jod) und Essig.
- Was bedeutet das Verbrauchsdatum?
Sehr leicht verderbliche Lebensmittel, die nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellen können, werden mit dem Verbrauchsdatum gekennzeichnet. Das Verbrauchsdatum nennt den letzten Tag, an dem das Lebensmittel noch verzehrt werden darf. Tag, Monat und gegebenenfalls das Jahr stehen entweder direkt hinter dem Wortlaut "zu verbrauchen bis", oder es muss dort angegeben werden, wo sich das Datum auf der Verpackung befindet.
Weder für das MHD noch für das Verbrauchsdatum ist genau festgelegt, an welcher Stelle auf der Verpackung der Hinweis stehen muss.
Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums: Kann ich Lebensmittel noch essen?
Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist das Lebensmittel nicht automatisch verdorben. Ob dieses Produkt noch genießbar ist oder nicht, lässt sich mit den eigenen Sinnen überprüfen. Nach Ablauf des Verbrauchsdatums sollte das Produkt jedoch nicht mehr verwendet werden. Der Verkauf eines Produkts nach Ablauf des Verbrauchsdatums ist verboten.
- Nettofüllmenge: Wie viel Lebensmittel steckt drin?
Bei manchen Verpackungen können Sie im Supermarkt nicht sehen, wie viel Lebensmittel tatsächlich enthalten ist. Denn Verpackungen gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Der tatsächliche Inhalt lässt sich so oft nicht einmal erahnen. Hier kann Ihnen der Blick auf die angegebene Füllmenge weiterhelfen.
Die Nettofüllmenge wird je nach Lebensmittel meist nach Gewicht (Gramm oder Kilogramm) oder nach Volumen (Milliliter oder Liter) bei zum Beispiel flüssigen Lebensmitteln angegeben. Es gilt:
- Auf "Leichtgewichten", die weniger als fünf Gramm wiegen, dürfen Füllmengenangaben fehlen.
- Bei konzentrierten Produkten, etwa für Suppen oder Salatsoßen, muss angegeben werden, wie viel Liter oder Milliliter das zubereitete Produkt ergibt.
- Speiseeis muss in Volumen gekennzeichnet werden. Aufgrund des hohen Lufteinschlags in manchen Speiseeisen kann es dadurch zu Fehleinschätzungen in Bezug auf den Grundpreis kommen
- Manche Lebensmittel, etwa bestimmte Sorten von Obst und Gemüse, können auch mit der Angabe der Stückzahl in den Handel gebracht werden.
Die tatsächliche Füllmenge muss nicht exakt der angegebenen Nettofüllmenge entsprechen. Hersteller dürfen die Füllmenge nur innerhalb einer Produktcharge im Mittel nicht unterschreiten. Gewisse Abweichungen einzelner Packungen sind innerhalb bestimmter gesetzlicher Toleranzgrenzen erlaubt. Wenn die Fertigpackung allerdings wesentlich weniger als die angegebene Inhaltsmenge auf die Waage bringt, kann man von einer
Unterfüllung sprechen.
- Pflicht zur Angabe des Firmennamens
Auf Fertigpackungen müssen der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmens angegeben sein. Diese Information ist wichtig für Verbraucher:innen sowie für Behörden, wenn es etwas zu beanstanden gibt.
Verantwortlich für die Information ist das Unternehmen, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel vermarktet wird. Das kann sowohl der Hersteller sein als auch der Verpacker oder der Verkäufer.
Wird das Lebensmittel außerhalb der EU hergestellt, muss der Importeur, der das Lebensmittel in der EU einführt, angegeben werden.
- Preisangabe: Grundpreis hilft beim Preisvergleich
Zusätzlich zu den Angaben auf der Verpackung muss bei jedem Produkt eindeutig zugeordnet sowie leicht erkennbar und deutlich lesbar der Gesamtpreis sowie der Grundpreis pro Mengeneinheit ausgezeichnet sein. Für Verbraucher:innen wird der Preisvergleich so wesentlich einfacher.
Der Grundpreis steht in der Regel zusammen mit dem Endpreis am Regal und bezieht sich auf ein Kilogramm oder einen Liter des Produkts. Bei Waren, für die das Abtropfgewicht anzugeben ist (etwa bei Konserven), bezieht sich der Grundpreis pro Mengeneinheit auf das Abtropfgewicht.
Eine Angabe des Grundpreises ist zum Beispiel nicht notwendig, wenn er identisch mit dem Endpreis ist (etwa 1 Liter Milch).
Mehr Preistransparenz bei Preisrabatten
Seit dem 28. Mai 2022 muss bei Preisermäßigungen der niedrigste Preis der letzten 30 Tage angegeben werden. Das sorgt für mehr Transparenz den Verbraucher:innen gegenüber. Die Vortäuschung eines hohen Rabatts durch einen kurzfristigen Preisanstieg ist somit nicht mehr möglich.